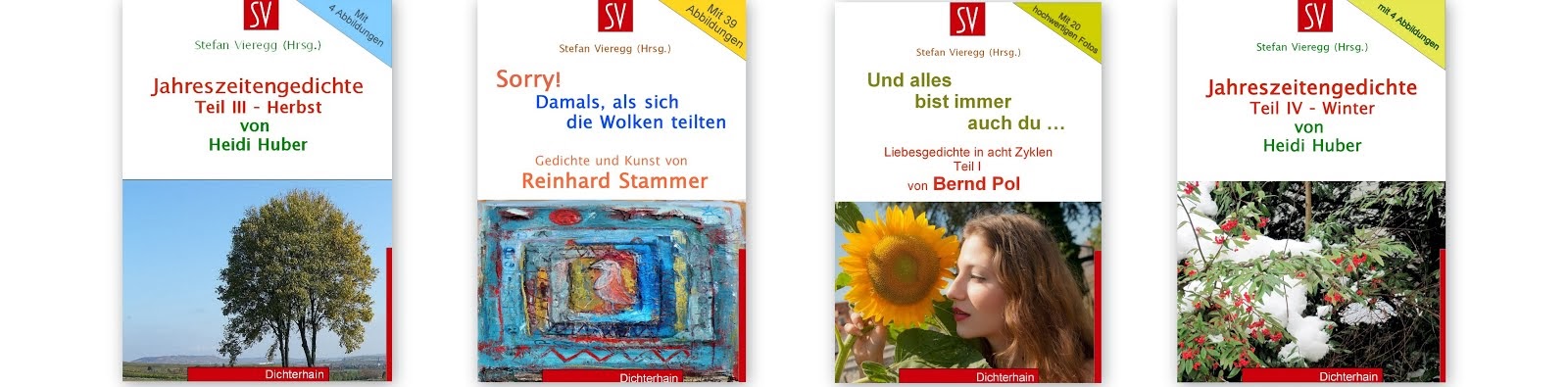Hinter den Karten
1
Im vorigen Sommer war ich eines Abends Gast der Baronin von Mascranny, einer jener Pariserinnen, die den altfranzösischen Feingeist über alles schätzen und dem geringen Überrest, der davon in unseren Tagen noch zu finden ist, die beiden Flügeltüren (eine genügt leider) ihrer Salons weit öffnen. Bekanntlich hat sich diese rare Sache vor nun schon beträchtlicher Zeit in ein grobes Ungeheuer verwandelt, das man »Intelligenz« benennt.
Die Familie Mascranny ist uralt und hochvornehm. Ihr Wappen ist von dem und jenem europäischen Herrscher mit Ehrenstücken bereichert worden, in Anerkennung von Diensten, die sie ihnen in den früheren Zeitläuften der Geschichte geleistet haben. Wenn die heutigen Fürsten nicht von ganz anderen Geschäften so arg in Anspruch genommen wären, hätten sie Anlaß, dieses schon so vielfach ausgezeichnete Wappen mit einer weiteren Zier zu schmücken, zum Lohn für die wirklich heldenhafte Art, mit der sich die Baronin um die Erhaltung der Plauderkunst im alten Sinne bemüht, dieses verlorenen Erbes nichtstuender Edelmenschen aus der Kultur der absoluten Monarchie. Wahrhaft geistreich und von echt adeligem Wesen, ist es Frau von Mascranny geglückt, ihr Heim zu einer Zufluchtsstätte der köstlichen Plauderei von ehedem zu machen, die vor dem Krämergeschwätz und dem Nützlichkeitsgerede unserer Zeit wer weiß wohin auswandern mußte. Bei ihr kann man den Geist des Ancien régime allabendlich noch finden, bis er eines Tages auch hier verstummen wird. Hier singt er sozusagen sein Schwanenlied. Treu der Überlieferung aus großen Tagen macht sich diese Plauderkunst nicht in leeren Redensarten breit, und Alleinreden ist geradezu etwas Unbekanntes. Nichts gemahnt an die Tageszeitung oder an das Parlament, diese beiden gemeinen Hauptstätten des neuzeitlichen Gedankenergusses. Hier perlt Witz und Geist in entzückenden, zuweilen tiefsinnigen, immer aber knappen Bemerkungen, oft nur in der besonderen Betonung eines einzigen Wortes oder gar nur in einer leichten alles sagenden Gebärde. In diesem begnadeten Salon habe ich zum ersten Male eine Macht kennengelernt, die man anderswo kaum ahnt, die Macht der Einsilbigkeit. Hier versteht man es, seine Antwort oder einen Zwischenruf mit einem einzigen Wörtchen zu geben, und zwar mit noch höherem Geschick als die Königin des kurzen Worts auf der Bühne, Mademoiselle Mars. Wenn sie in der Vorstadt Saint-Germain erscheinen könnte, wäre sie rasch entthront, denn die Damen der großen Gesellschaft verfügen über unendlich feinere Künste als eine Schauspielerin, die klassische Komödiengestalten verkörpert.
An jenem Abend machte man eine Ausnahme. Die Stimmung gab Einsilbern das Feld nicht frei. Als ich kam, sah ich eine Menge Leute bei der Baronin, ihre sogenannten Getreuen, und die Unterhaltung war wie stets voll Schwung und Leben. Wie fremdländische Blumen in Jaspisvasen auf hohen Sockeln, so nahmen sich die Gäste dieses Hauses aus. Engländer, Polen, Russen waren darunter, aber allesamt doch Franzosen, in ihrer Sprache, Lebensart und Weltanschauung. Auf einer gewissen Höhe der Gesittung ähneln sich die Menschen der ganzen Erde.
Es war gerade die Rede von Romanen. Ich weiß nicht, wie man just darauf gekommen war; denn über Romane sprechen, bedeutet, daß jeder von seinem eigenen Leben redet. Es braucht wohl nicht betont zu werden, daß man in solch einem Kreise von Weltkindern keine literarischen Schulmeistereien erwog. Das Wesen der Dinge, nicht ihre Form, galt hier als Reiz. Diese überlegenen Sittenrichter, diese vielseitigen Kenner der Leidenschaft und des Lebens, deren tiefe Erfahrungen sich hinter lässigen Worten und zerstreuten Mienen verbargen, sahen im Romane nichts als einen Spiegel des Tuns und Treibens der Menschen. Aber was ist ein Roman im Grunde auch anderes?
Übrigens mußte man schon eine Weile über diesen Gegenstand gesprochen haben, denn in ihren Gesichtern leuchteten bereits die Seelen. Die angeregten Geister moussierten. Nur drei oder vier der Anwesenden verhielten sich schweigend, die Stirn gesenkt, den Blick versonnen auf den beringten Händen, die über den Knien ruhten, vielleicht in Versuche verloren, einer Träumerei Gestalt zu geben, was ebenso schwer ist, wie ein Gefühl zu vergeistigen.
Die Aufmerksamkeit war dermaßen auf einen Punkt gerichtet, daß ich mich unbemerkt einschlicht und hinter dem glattschimmernden Nacken der schönen Gräfin von Damnaglia Platz fand, die, ihre Lippen an den Saum ihres zusammengeklappten Fächers gedrückt, aufmerksam lauschte wie alle die anderen. Hier wußte man, daß Zuhören Genuß ist. Es begann zu dunkeln. In das Rot des Tages rieselte Abenddämmerung wie in ein glückliches Leben. Man saß im Kreise, und die Herren und Damen in ihrer verschiedenen losen, aber achtsamen Haltung formten im Halblicht des Raumes gleichsam die Glieder eines Kranzes, einer lebendigen Armkette; und die Herrin des Hauses mit ihrem Ägypterinnenprofil, auf ihrem Liegesitz hingestreckt wie Kleopatra, bildete das Schlußstück. In einer offenen Glastür leuchtete ein Stück Himmel über dem Balkon, auf dem ein paar Menschen standen. Die Luft war so rein und klar und unten der Quay d'Orsay so still, daß man draußen jedes drinnen gesprochene Wort ganz deutlich vernahm, trotz der venezianischen Vorhänge, die den schwingenden Metallklang der redenden Stimme einfingen und dämpften. Sowie ich den Sprecher erkannte, dünkte mich die allgemeine Spannung nicht mehr erstaunlich. Sie war keine bloße Höflichkeit. Und auch das Wagnis, gegen den erlesenen Geschmack des Hauses einmal länger das Wort zu behalten, war mir jetzt nicht weiter wunderbar.
Es redete nämlich der blendendste Plauderer im Reiche dieser Kunst, übrigens ein Meister in noch anderen Dingen. Wenigstens raunten die Klatschbasen oder die Verleumder – wer vermag dieses schlimme Paar auseinanderzuhalten? – einander zu, er sei der Held so mancher seltsamen Geschichte, die er hier wohlweislich nicht zum besten gäbe.
»Die schönsten Romane des Lebens«, sagte er gerade, als ich mich hinter der Gräfin auf meiner Sofaecke niederließ, »sind wirkliche Geschehnisse, die man im Vorübergehen mit dem Ellbogen oder gar mit dem Fuß streift. Wir alle haben deren miterlebt. Romane ereignen sich allerorts, während an der Weltgeschichte teilzunehmen nicht jedem widerfährt. Ich meine nun nicht jene gewaltsamen Schicksalsschläge, jene Tragödien, die kühne übergroße Leidenschaft vor der Nase der ehrbaren öffentlichen Meinung aufführt. Nein, ganz abgesehen von solchen seltenen sensationellen Fällen, die unsere ehedem nur heuchlerische, heutzutage auch noch feige Gesellschaft hin und wieder aufregen, gibt es wohl niemanden unter uns, der nicht einmal Zeuge gewesen wäre des heimlichen und rätselhaften Waltens der Gefühle und Leidenschaften, die dort ein Herz brechen und da ein ganzes Menschenleben vernichten, ohne daß man mehr vernommen hätte als einen dumpfen Laut, den die Welt überhört oder überschreit. Wo man deren Vorgänge am wenigsten vermutet, da geschehen sie. Als ich noch ein kleiner Junge war, habe ich gesehen, nein, besser gesagt, geahnt und erraten, wie sich solch ein grausiges furchtbares Drama im geheimen abspielte, obgleich die Mitspieler tagtäglich vor aller Augen standen. Es war eine blutige Komödie – um mich Pascals Ausdrucks zu bedienen – hinter einem dichten Vorhang, dem Vorhang des häuslichen Lebens. Das wenige, das sich von solchen Vorgängen der Außenwelt offenbart, ist düsterer und macht tieferen Eindruck auf uns, im Augenblick wie in der Erinnerung, als ein ganzes Trauerspiel, das sich offen vor unseren Augen abrollt. Das, was wir nicht wissen, verhundertfacht ja die Wirkung dessen, was wir wissen. Ist es nicht so? Ich bilde mir ein: Die Hölle, mit einem Male überschaut, kann lange nicht so gräßlich sein wie ein Einblick in sie, getan durch ein Kellerloch.«
Hier machte der Erzähler eine kleine Pause. Vielleicht erwartete er Widerspruch, aber er fand auf aller Gesichter nichts denn die größte Spannung. Die junge Sibylle von Mascranny, die ihrer Mutter zu Füßen kauerte, schmiegte sich näher an sie, zusammenschauernd, als sei ihr eine Natter zwischen den kleinen Mädchenbrüsten und dem Mieder durchgeschlüpft.
»Mutter«, flüsterte sie mit der Unbekümmertheit eines verwöhnten Kindes, das zur Tyrannin erzogen wurde. »Sag ihm, er soll uns keine so gruselige Geschichte erzählen!«
»Wenn Sie es wünschen, gnädiges Fräulein, so höre ich auf!« erklärte der noch Schweigende, der die Worte vernommen hatte, die bei allem Freimut doch zart und kindlich klangen. In der Nähe dieser jungen Seele lebend, kannte er ihre Neugier und ihre Furcht. Sie empfand vor allem, was ihr entgegentrat, eine eigentümliche seelische Erregung, ähnlich der, die man körperlich hat, wenn man den Fuß in ein kaltes Bad setzt und man mehr und mehr den Atem verliert, je tiefer man taucht.
Die Baronin strich mit der Hand liebkosend über den Scheitel ihrer so frühreif-nachdenklichen Tochter und sagte:
»Sibylle erkühnt sich wohl nicht, meinen Gästen das Wort zu entziehen. Wenn sie sich fürchtet, so steht ihr das Mittel der Ängstlichen zu Gebote: davonzulaufen!«
Aber das launische kleine Mädchen, ebenso begierig auf die Geschichte wie ihre Mutter, entfloh nicht, sondern richtete sich auf. Ihr magerer Körper bebte vor banger Erwartung, und ihre grundlosen schwarzen Augen hefteten sich auf den Erzähler wie auf einen schrecklichen Abgrund.
»Jetzt wird aber erzählt!« rief Fräulein Sophie von Revistal mit einem strahlenden Blick ihrer braunen Augen, die trotz ihres feuchten Schimmers verteufelt flammten, auf den Zögernden. »Fangen Sie an! Wir sind alle Ohr!«
Und er begann. Ich will mir Mühe geben, die Geschichte nachzuerzählen, wenngleich ich natürlich die Schatten und Lichter der Stimme und die Gebärden des Erzählers nicht wiedergeben kann, ebensowenig wie die starke Wirkung, die er auf alle Anwesenden ausübte.
Alle bisherigen Teufelskinder-Geschichten Fortsetzung folgt